André Gunthert: Das geteilte Bild
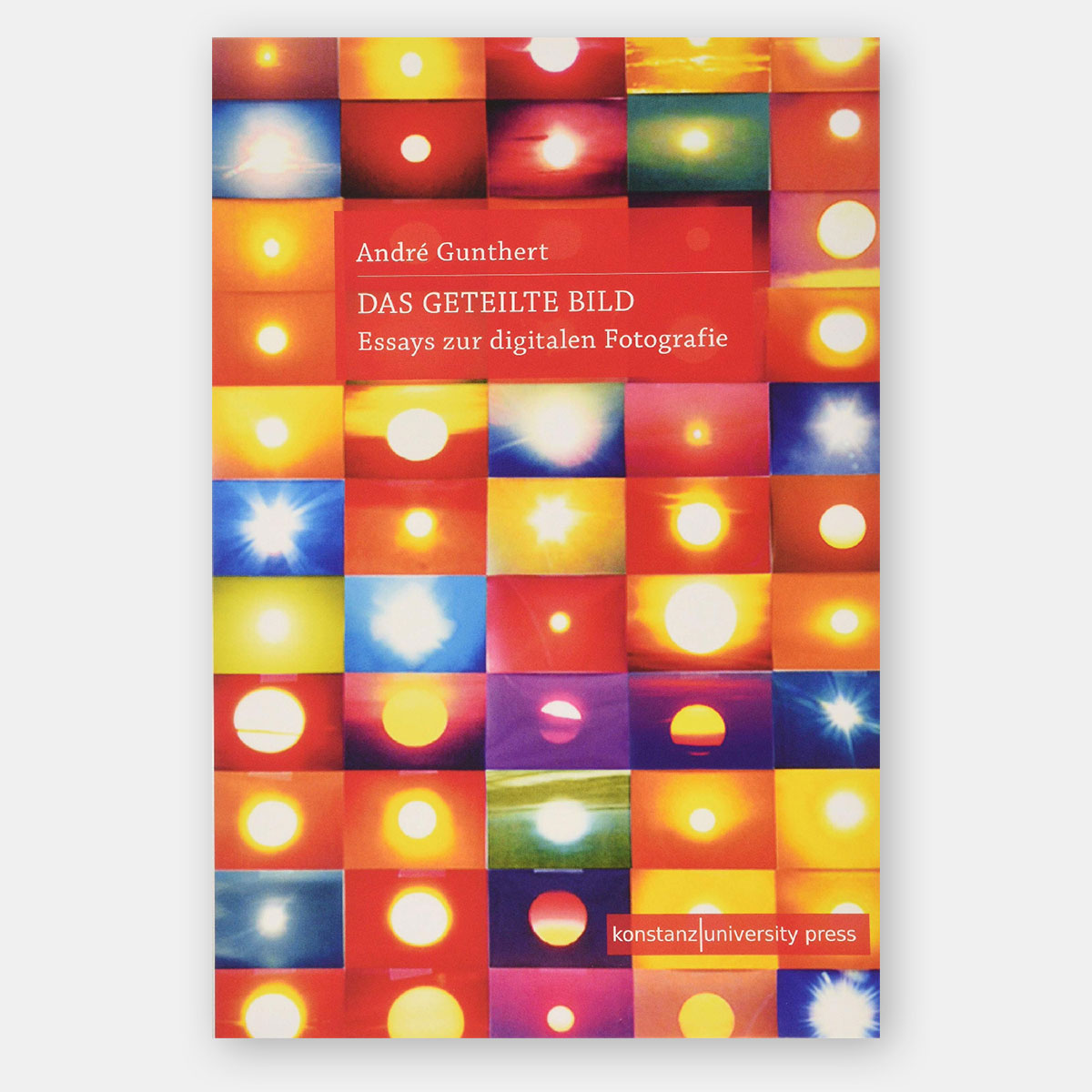
27.10.2020
Besprochen von Matthias Gründig
Unter dem Titel »Das geteilte Bild« erschien 2019 erstmals eine Sammlung von Aufsätzen des französischen Fotohistorikers André Gunthert, der an der École des hautes études en sciences sociales (EHESS) in Paris lehrt, in deutscher Übersetzung. Das Original, »L'image partagée« (Éditions Textuel), wurde bereits vier Jahre zuvor publiziert, was in Hinblick auf den Inhalt der zwölf – bzw. dreizehn, zählt man eine kurze Einführung Guntherts mit – hierin versammelten Texte und damit auch für deren eigene Historizität eine signifikante Zeitspanne darstellt. Geschrieben in der Zeit zwischen 2004 und 2015 bewerkstelligen die essayistischen Texte, die zuvor teils in der von Gunthert gegründeten Zeitschrift »Études photographiques« (1996–2017) erschienen, genaue Beschreibungen und Analysen ihrer medialen Gegenwart, jener des sich formierenden, dynamischen Web 2.0. Es handelt sich dabei um »Dokumente des Übergangs« (7), wie es die Hildesheimer Medienwissenschaftlerin Stefanie Diekmann, die den Band sehr gut lesbar übersetzt hat, in ihrem informativen Vorwort ausdrückt. Hierin findet sie auch eine griffige Formel für Guntherts Beiträge zur Fototheorie dieser Übergangszeit: »mehr Bourdieu als Barthes, mehr Soziologie als Ontologie; ästhetische Aspekte hingegen nur dann, wenn sie etwas über Nutzungs- und Verwendungsformen erzählen« (9). Vor allem letzteres, der Fokus auf den Gebrauch der Bilder und ihre Kontexte lässt sich sogleich an den durchgehend farbigen Abbildungen überprüfen: Reproduktionen von Titelseiten französischer Tageszeitungen, Screenshots von Youtube-Fenstern, von sozialen Netzwerken und anderen Websites, nicht zuletzt Zusammenstellungen von Selfies, Memes und anderen Phänomenen digitaler Bildkulturen. Nie geht es dabei um ein irgendwie geartetes ikonisches Bild im Singular, stets dagegen um digitale Bilder im Plural als Medium dialogischer Kommunikation und öffentlicher Diskurse sowie um die technischen und sozialen Voraussetzungen, die Dialog und Diskurs ermöglichen.
Die Rede vom geteilten Bild, so wird bereits im Vorwort klar gemacht, beansprucht explizit keine einheitliche Theorie der digitalen Fotografie. Vielmehr handelt es sich dabei um einen Sammelbegriff, unter dem verschiedene Aspekte des vielgestaltigen zeitgenössischen Bildgebrauchs Platz finden. So stellt auch der Einführungstext »Das fluide Bild« dem Buch den nicht-fixierbaren Charakter des digitalen Bildes emblematisch voran: »Das Revolutionäre an der digitalen Fotografie ist ihre Fluidität« (16). Diese markiere eine wichtige Etappe »in der fortschreitenden Diffusion der Bilder, indem sie ihnen eine unendlich gesteigerte Appropriierbarkeit verleiht« (17). Klar positioniert sich Gunthert dabei gegen kulturpessimistische und medienessenzialistische Perspektiven, beispielsweise jene W.J.T. Mitchells, nach der das Digitale ein postfotografisches Zeitalter eingeläutet habe, in dem der Wahrheitsanspruch des Bildes zerbrochen sei. »Die Katastrophe hat nicht stattgefunden« (26) - wie Gunthert überzeugend anhand des medialen Gebrauchs der Fotografien aus Abu Ghraib zeigt (»Das digitale Bild zieht in den Krieg«). Die digitale Praxis habe gezeigt, »dass die Wahrhaftigkeit des Bildes nicht von seiner Ontogenese« abhänge (33). Anstatt das Aufkommen des Digitalen als Revolution im Sinne einer harten Zäsur zu werten, zeichnet sich das Feld, das Gunthert entwirft, durch ein komplexes Zusammenspiel von Kontinuitäten, Diskontinuitäten und Verschiebungen aus. So erinnert er, dass seit dem Beginn des Jahrtausends eine Revolution des Kameradesigns oder des Zeitschriftenlayouts durch das Aufkommen digitaler Bildtechniken ganz offenbar nicht stattgefunden hat, wohingegen sich insbesondere die Möglichkeiten, Fotografie miteinander zu teilen, dramatisch vervielfacht und verändert haben.
Einen großen Anteil an den allmählichen Verschiebungen des Bildgebrauchs seit der Jahrtausendwende schreibt Gunthert einerseits der parallel aufkommenden Handy- bzw. später Smartphonetechnik, andererseits der Entwicklung von Image Hosting Websites wie Flickr zu. Die Gründung von Flickr 2004 markiere »zweifellos einen Wendepunkt in der Geschichte der Medien« (54). Gut folgen lässt sich einer solchen steilen These nicht zuletzt, weil Gunthert schreibend ein stetes Misstrauen gegenüber Verallgemeinerungen beweist, das sich in einer detailgenauen Verfolgung seiner Akteure zeigt. In »Alle Journalisten?. Die Attentate von London oder der Auftritt der Amateure« etwa widmet er sich kritisch der These der Konkurrenz des sogenannten Bürgerjournalismus zu herkömmlichen Nachrichtenmedien, die um 2005 heiß diskutiert wurde. Hier zeichnet er genau die Art und Weise nach, wie Privataufnahmen vom Schauplatz der verheerenden Attentate vom 7. Juli des Jahres auf die Titelseiten von Tageszeitungen gelangten: In einem Fall sendet Adam Stacey eine Aufnahme von seinem Handy an einen Freund, der es unter Verwendung einer Creative Commons-Lizenz auf eine von ihm betriebene Hosting-Website lädt, von der es auf Flickr und Wikinews und zuletzt vom Nachrichtensender Sky News appropriiert wird. Gunthert dekonstruiert anhand dieses und anderer Beispiele die vermeintlich klare Opposition sowie Konkurrenz von Amateuren und Profis und evoziert so eine sich zusehends komplizierende Medienlandschaft, in der Fotografien zuweilen als »parasitäre« Bilder auftreten, die Websites wie Flickr kurzerhand in Nachrichtenmedien wider Willen verwandeln. Maßgeblich für die »Destabilisierung der Bildökonomie« sei eben nicht die Sozialfigur des Amateurs, die Gunthert insbesondere in den Texten »Das parasitäre Bild« und »Ist die Fotografie noch modern?« gegen ökonomische Vorbehalte verteidigt, sondern die »neue Indizierbarkeit der digitalen Fotografie« (75) im Kontext digitaler, vernetzter Datenbanken und Archive. Besonders der namensgebende Aufsatz »Das geteilte Bild. Wie das Internet die Ökonomie der Bilder verändert hat« zeigt auf eindrückliche Weise, wie das verstärkte Aufkommen von sogenanntem User Generated Content um die Mitte der Nuller Jahre Verwerfungen in einer kommerziellen Medienlandschaft erzeugte und nicht zuletzt zu einer Kriminalisierung von Amateuren führte, die Gunthert beispielhaft für Frankreich nachzeichnet. Dabei interessieren ihn weniger die Erfolgsgeschichten von Youtube, Flickr, Facebook, Instragram und so weiter als deren Verknüpfung, aus der sich ein »kohärentes System der bildbezogenen Sozialisation« (88) entwickelt. Er gibt damit unter anderem Angebote zum Verständnis der Genese heutiger digitaler Nachrichtenmedien, die sich insbesondere durch ihre Einbindung externer Inhalte von Twitter, Youtube und anderen auszeichnen.
Auf den zentralen Paradigmenwechsel des Amateur-Bildgebrauchs »von der Kontribution zum Dialog« (95) macht »Die Kultur des Sharing oder die Rache der Vielen« aufmerksam. Wie auch in den folgenden Texten beschäftigt Gunthert hier der kommunikationsmediale Charakter digitaler Fotografie, der in Zeiten von Whatsapp, Instagram und Snapchat kaum plausibilisiert werden muss und für den er den Begriff des »dialogischen Bildes« (im Original »l'image conversationelle«) findet. Vergleichbar zu den Schriften Vilém Flussers wird hier Dialog »als Modell kultureller Produktion« gefasst, das sich durch »Egalität und Reziprozität der Interaktion« (99) auszeichnet. Entsprechend hebt Gunthert für den dialogischen Bildgebrauch besonders die Abhängigkeit einer technischen, juristischen, stilistischen oder anderweitigen Appropriierbarkeit hervor, die für die Zirkulation von digitalen Bildern grundlegend ist und in der Praxis eine eigene »Ästhetik der Appropriation« (105) begründet hat, die konservativen, distinktionsgetriebenen Ästhetiken entgegensteht und sich, wie im Fall von Memes, durch eine Betonung des Ludischen, Komischen und Lächerlichen aktiv von diesen abgrenzt. In diesem Kontext lässt sich auch das Phänomen des sogenannten Selfies begreifen, dem Gunthert den letzten Beitrag widmet und von dem er meint, es sei »nicht nur eine Erweiterung des Selbstporträts; es ist zur Standarte der machtvollen Autonomisierung kultureller Praktiken geworden, die durch den digitalen Wandel befördert werden« (171). Der Öffentlichkeit des Selfie diametral entgegengesetzt verweist er zugleich in einem ebenso kurzen wie unkonventionellen und schönen Essay auf die »Fotos, die man nicht zeigt«, »die man nicht zeigen muss, sondern die man nur mit denjenigen teilt, die man liebt, um sie dann in einer Ecke aufzubewahren, wie eine Reliquie des Glücks« (114). Auch im Selfie-Zeitalter sind die Intimität und Privatheit der Fotografie nicht verschwunden.
Mit »Das geteilte Bild« zeichnet sich André Gunthert als feinfühliger Praxeograph der digitalen Bildwelten unserer Gegenwart aus. Seit 2015 hat sich in diesen natürlich viel getan, sodass sich Leserinnen und Leser beständig zu Transfers auf die jüngste Vergangenheit aufgefordert fühlen werden. Eine weiter in die Geschichte der Fotografie, gar ins 19. Jahrhundert zurückreichende Fundierung des geteilten und dialogischen Bildes findet bis auf einen kurzen Rückbezug auf Postkarten, so lohnenswert dies wäre, nicht statt, was dem Erkenntniswert der Betrachtungen Guntherts jedoch keinen Abbruch tut. Lesenswert ist das Buch nicht zuletzt aufgrund der gewinnbringenden Verknüpfung von technikgeschichtlichen und soziologischen Interessen, denen Gunthert mit einer klar egalitären Haltung nachgeht und in seinen kritischen Analysen die Komplexität der betrachteten Situation nie einfachen Erklärungsmustern unterwirft.
André Gunthert: Das geteilte Bild. Essays zur digitalen Fotografie, Konstanz (Konstanz University Press) 2019. 172 Seiten, 49 Farbabbildungen, ISBN 978-3-8353-9110-9.
Diese Rezension ist zuerst am 15. September 2020 in sehepunkte 20 (2020), Nr. 9 erschienen.